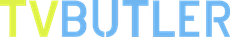Punkt eins Wie die Gesellschaft auf Terror reagiert
Di, 25.02. | 13:00-13:55 | Ö1
Am Sonntag fand in Wien eine kleine Demonstration statt: 300 Austrosyrerinnen und -syrer zeigten bei einem Gedenkmarsch ihre Solidarität mit den Familien der Anschlagsopfer von Villach bei einem Gedenkmarsch. Sie demonstrierten auch gegen islamistischen Terror – und gegen Rassismus. Denn seit dem Attentat von Villach häufen sich öffentliche Schuldzuweisungen und Pauschalverdächtigungen gegen muslimische Zuwanderer. Terroranschläge wie in Villach oder jener in Wien im November 2020 zielen auf symbolische Effekte ab: Sie wollen das Sicherheitsgefühl einer Gesellschaft und damit den sozialen Zusammenhalt angreifen. Und das gelingt auch. In den Sozialen Medien werden Hasstiraden gegen Asylsuchende verbreitet, unterschiedliche politische Stimmen fordern drastische Maßnahmen mit Blick auf Migrantinnen und -Migranten. Von einer Asylobergrenze war bereits die Rede oder davon Flüchtlinge wegen möglicher islamistischer Radikalisierung pauschal zu überwachen.Andere mahnen nun zu Solidarität, dazu keine weiteren Spaltungen der Gesellschaft zuzulassen. Die Antwort auf den Terror dürfe nicht Hass und Gewalt sein. Sie fordern ein gemeinsames Vorgehen gegen Terror im Sinn von Prävention, also im Kampf gegen Extremismus und Gewalt auf soziale Integration zu setzen. Sie erinnern an das, was der damalige norwegische Premierminister Jens Stoltenberg nach dem Anschlag eines Rechtsextremen 2011 auf der Insel Utoya mit 77 Todesopfern sagte: „Unsere Antwort ist mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Menschlichkeit. Aber nie Naivität."Wie also mit der psychischen Belastung umgehen, die der Terror und die Berichterstattung darüber bei vielen Menschen hinterlässt? Wie kann verhindert werden, dass solche traumatischen Erfahrungen Wut und Ärger auf bestimmte Bevölkerungsgruppen auslösen? Und was muss getan werden, um einer Spaltung der Gesellschaft vorzubeugen? Mit Fragen wie diesen beschäftigen sich die Psychologin Brigitte Lueger-Schuster von der Universität Wien und der Soziologe Wolfgang Aschauer von der Universität Salzburg. Beide sind Gäste bei Marlene Nowotny, um über aktuelle Reaktionen auf die Terrorerfahrungen zu sprechen, wie solche traumatischen Erfahrungen verarbeitet werden und welche Unterstützung es dabei braucht, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern.Rufen Sie uns an und reden Sie mit unter 0800 22 69 79 kostenfrei aus ganz Österreich oder schreiben Sie uns per E-Mail an punkteins(at)orf.at
in Outlook/iCal importieren